| Zurück |
Impressum
Datenschutz
In unserem Sonnensystem
bewegen sich um den Zentralkörper
außer den Planeten und Planetoiden noch große Mengen von
Kleinkörpern, die teils aus großen Entfernungen weit
außerhalb der Neptunbahn in die engere Planetenwelt eindringen,
um hier ihr Ende in den einzelnen Planeten und soweit das nicht der
Fall sein sollte, in der Sonne selbst zu finden, teils periodisch
auftauchen und wieder verschwinden; manche erscheinen nur einmal,
umlaufen die Sonne in hyperbolischer Bahn und enteilen dann für
immer aus der Sonnennähe und damit unserem Gesichtskreis.
Dies sind die unperiodischen Kometen und Irrsterne im wirklichen
Wortsinn, die erstgenannten periodische Kometen, Meteore, Feuerkugeln und
Sternschnuppen sein.
In der Regel wurden die letztgenannten drei Arten von Körpern als Reste von Kometen angesehen, besonders diejenigen, die in Schwärmen aufzutreten pflegen; von dieser Ansicht ist die Wissenschaft abgekommen und Newcomb-Engelmann sagt: "....aber daß alle Schwärme von Kometen abstammen, kann nach dem heutigen Stande der Kenntnisse nicht mehr angenommen werden." Sie werden aber immer noch als wesensgleich angenommen und zwar legt man ihrem stofflichen Aufbau die Vorstellung zugrunde, daß sie entweder rein metallische oder mineralische Bildungen seien, oder auch als Gemisch aus solchen Zusammensetzungen auftreten können. Wir werden zeigen, daß noch eine vierte Form, die für viele irdische Lebensvorgänge von großer Wichtigkeit ist, vorkommt, nämlich im Zustande als reine Eiskörper, und durch die Einführung dieser Vorstellung verschwinden viele Schwierigkeiten, die sich der Erklärung gerade der wichtigsten Fragen entgegenstellen, die die verschiedenen Erscheinungsarten angeregt haben.
In der Regel wurden die letztgenannten drei Arten von Körpern als Reste von Kometen angesehen, besonders diejenigen, die in Schwärmen aufzutreten pflegen; von dieser Ansicht ist die Wissenschaft abgekommen und Newcomb-Engelmann sagt: "....aber daß alle Schwärme von Kometen abstammen, kann nach dem heutigen Stande der Kenntnisse nicht mehr angenommen werden." Sie werden aber immer noch als wesensgleich angenommen und zwar legt man ihrem stofflichen Aufbau die Vorstellung zugrunde, daß sie entweder rein metallische oder mineralische Bildungen seien, oder auch als Gemisch aus solchen Zusammensetzungen auftreten können. Wir werden zeigen, daß noch eine vierte Form, die für viele irdische Lebensvorgänge von großer Wichtigkeit ist, vorkommt, nämlich im Zustande als reine Eiskörper, und durch die Einführung dieser Vorstellung verschwinden viele Schwierigkeiten, die sich der Erklärung gerade der wichtigsten Fragen entgegenstellen, die die verschiedenen Erscheinungsarten angeregt haben.
In mondlosen, aber sternklaren
Nächten hat wohl schon jeder eine
Sternschnuppe, einen fallenden und einen leuchtenden Streifen hinter
sich herschleppenden Stern gesehen; manchem ist es wohl vergönnt
gewesen, ein sog. Meteor erblickt oder wenigstens gehört zu haben, denn der
Hauptunterschied zwischen beiden Erscheinungen ist zunächst der,
daß die erstgenannten lautlos dahinhuschen, während die
letzten sich oft durch ein vernehmbares Geräusch in der Luft
bemerkbar machen und gelegentlich auch unter Explosionserscheinungen
zerbersten und Trümmer zur Erde fallen lassen.
Bevor wir uns mit dem Wesen der
Sternschnuppen näher
beschäftigen, soll erst einmal auf die jetzt herrschende, aber,
wie
wir sehen werden, unrichtige Annahme hingewiesen werden, die darin
besteht, daß Meteore und Sternschnuppen immer ein und dasselbe
sein müßten. An der Tatsächlichkeit von
Meteoreinstürzen ist nicht zu zweifeln; aus dem Altertum, dem
Mittelalter und der Neuzeit sind genügend sicher verbürgte
Fälle von Steinhagel und aus der Luft herabgestürztem Eisen
bekannt. Und doch gab es um die Mitte des 18. Jahrhunderts eine
Bewegung unter den Gelehrten, welche solche Vorkommnisse in den Bereich
der Fabel und der überhitzten Einbildungskraft einzelner Menschen
verwies, weil sie mit den Naturgesetzen im Widerspruch
ständen. Man ging so weit, Meteorsteine, welche als kostbare
Stücke die Sammlungen zierten, wegzuwerfen, um sich von dem
Verdacht zu reinigen, man könnte solchen Dingen Glauben
schenken. Am 26. Mai 1756 fielen bei Hraschina zwei
Meteorsteinmassen; in der urkundlichen Aufnahme durch das
bischöfliche Seminar zu Agram heißt es: "Daß das Eisen
vom Himmel gefallen sein soll, mägen der Naturgeschichte Unkundige
glauben; aber unseren Zeiten wäre es unverzeihlich, solche
Märchen auch nur wahrscheinlich zu finden." Und als im Jahre
1790 die Munizipalität von Juilac in der Gascogne eine mit mehr
als 300 Unterschriften von Augenzeugen versehene Urkunde über den
Steinfall, der sich dort am 24. Juli abends 9 Uhr ereignet hatte, der
Pariser Akademie einsandte, fand man es sehr erheiternd, daß man
über eine solche Absurdität ein authentisches Protokoll
erhalten könne. "Wie traurig ist es nicht, eine ganze
Munizipalität durch ein Protokoll in aller Form Volkssagen
bescheinigen zu sehen, die nur zu bemitleiden sind!" so sagt
darüber das "Journal des sciences utiles". Heute zweifelt
niemand mehr an der kosmischen Natur der Meteorsteinfälle, und
wenn von irgendeiner Seite ein bemerkenswerter Meteorfall gemeldet
wird, rüstet man sogar Expeditionen aus, in der Hoffnung,
Trümmerstücke zu finden. Es ist auch öfter
geglückt, Sprengteile, die man nach der Explosion des Meteors
fallen sah, alsbald aufzufinden, und man konnte die Wahrnehmung machen,
daß sie eine von der Erhitzung angeschmolzene Oberfläche
besaßen, während das Innere kalt geblieben sein mußte,
denn die kristallinische Struktur zeigte keine Veränderung, die
auf Erhitzung schließen läßt.
Nun wird behauptet, daß die mit lautem Krachen unter Feuererscheinungen und Ausstreuen eines Hagels von mineralischen oder metallischen Bruchstücken zur Erde niedergehenden Fremdkörper richtige Meteore seien, daß die den Nachthimmel durchhuschenden, einzelnen und zu bestimmten Zeiten in größeren Massen auftretenden leuchtenden Eindringlinge auch Meteore, aber kleinere seien; nur weil sie, ohne die Erde zu erreichen, in der Luft spurlos verdampfen, verdienten sie einen anspruchsloseren Namen, deshalb wurden sie Sternschnuppen genannt. Diese Ansicht, besonders im Hinblick auf die vermutete Kleinheit, ist aber falsch, denn die Sternschnuppen sind ganz etwas anderes als die Meteore; sie sind ziemlich große Körper aus purem Eise und erscheinen uns nicht deshalb leuchtend, weil sie durch Reibung in dem Luftmantel der Erde heiß und glühend werden, sondern weil sie, wie der Mond, die Venus und die anderen Planeten, im reflektierten Sonnenlichte leuchten, und zwar weit außerhalb jeder Berührungsmöglichkeit mit der irdischen Atmosphäre. Diese Behauptung ist so überraschend, daß sie zuerst Verwunderung auslösen muß; bei näherer Betrachtung gewinnt sie aber eine durchschlagende Beweiskraft.
Nun wird behauptet, daß die mit lautem Krachen unter Feuererscheinungen und Ausstreuen eines Hagels von mineralischen oder metallischen Bruchstücken zur Erde niedergehenden Fremdkörper richtige Meteore seien, daß die den Nachthimmel durchhuschenden, einzelnen und zu bestimmten Zeiten in größeren Massen auftretenden leuchtenden Eindringlinge auch Meteore, aber kleinere seien; nur weil sie, ohne die Erde zu erreichen, in der Luft spurlos verdampfen, verdienten sie einen anspruchsloseren Namen, deshalb wurden sie Sternschnuppen genannt. Diese Ansicht, besonders im Hinblick auf die vermutete Kleinheit, ist aber falsch, denn die Sternschnuppen sind ganz etwas anderes als die Meteore; sie sind ziemlich große Körper aus purem Eise und erscheinen uns nicht deshalb leuchtend, weil sie durch Reibung in dem Luftmantel der Erde heiß und glühend werden, sondern weil sie, wie der Mond, die Venus und die anderen Planeten, im reflektierten Sonnenlichte leuchten, und zwar weit außerhalb jeder Berührungsmöglichkeit mit der irdischen Atmosphäre. Diese Behauptung ist so überraschend, daß sie zuerst Verwunderung auslösen muß; bei näherer Betrachtung gewinnt sie aber eine durchschlagende Beweiskraft.
Ohne uns vorläufig um die
Entstehung und Herkunft
des
kosmischen Eises zu bekümmern, fassen wir einmal einen aus den
Endgebieten unseres Sonnensystems stammenden Eiskörper ins Auge,
der entweder straks zur Sonne ziehen kann, oder dem durch den
Einfluß der Anziehung eines Planeten, z. B. des Jupiters, eine
andere Bahn aufgezwungen wurde, auf der er die Sonne erst auf einem
Umweg erreichen wird. Dieser Weg kann in der Nähe der Erde
vorbeiführen, und wenn der Körper
groß genug ist, um ihn während einer klaren Nacht als
von der Sonne erleuchteten Gegenstand wahrnehmen zu können, dann
werden wir ihn in der Tat sehen müssen; einen großen schon
in bedeutender Entfernung einen kleinen, wenn er der Erde näher
ist. Gewöhnlich ist es ein mehr oder weniger hell
leuchtender Streifen, wie wenn sich ein Stern in Bewegung gesetzt
hätte, den wir als vorbeihuschenden Körper sehen; es kommt
aber auch vor, daß die Lichterscheinung in ganz dünnem
Strich anfängt, stärker wird und in einem gewissen
Höhepunkt des Glanzes erlischt. Auch das Umgekehrte wird
beobachtet: die plötzlich in stärkerem Glanze auftretende
Sternschnuppe erlischt während des Fluges allmählich.
Man findet in der Tagespresse oder in populären astronomischen und
naturwissenschaftlichen Zeitschriften wohl auch ab und zu eine
Mitteilung, nach der ein Beobachter eine sichelförmige
Sternschnuppe, ein anderer gar eine Feuerkugel von deutlich
rechteckiger Form gesehen haben will. Eine Erklärung
für diese auffallenden Erscheinungen zu geben, fällt bei
unserer Anschauungsart über ihr Zustandekommen nicht schwer.
Ist z. B. ein runder Eiskörper so groß, daß man ihn
schon als einen winzigen Mond bezeichnen könnte, dann muß er
je nach der Stellung, die er zur Sonne und dem Standort des Beschauers
auf der Erde gerade inne hat, auch die gleichen
Beleuchtungsverhältnisse annehmen, die wir vom Monde kennen, und
da ist es sehr wohl denkbar, daß ein gutes Auge bei klarem
Nachthimmel eine solche halbbeleuchtete Kugel als Sichel am Himmel
dahinfahren sieht. Es liegt aber kein Grund vor zu der Annahme,
daß jeder Eiskörper immer eine Kugel sein müsse.
Er kann auch ein Trümmerstück eines größeren, aus
irgendeinem Grunde geplatzten Boliden sein; dann kann er auch ebene Bruchflächen
besitzen. Steht eine solche so zur Sonne und dem Beschauer,
daß diesem das reflektierte Licht in das Auge fällt, dann
muß er die Form der
Fläche erkennen; somit sind Beobachtungen, die einen Rhombus
gezeigt haben sollen, keineswegs als Selbsttäuschungen
hinzustellen, sondern als Tatsachen zu bewerten.
Wie ist es aber mit dem
erwähnten plötzlichen Erlöschen
einer Sternschnuppe aus höchstem Glanze oder mit dem umgekehrten
Fall, daß eine solche in vollstem Glanze auftritt, um dann
abnehmend zu verschwinden? Um uns diesen Vorgang klarzumachen,
müssen wir uns die Erde frei im Himmelsraum schwebend vorzustellen
suchen, und zwar zur Nachtzeit. Dann ist die Sonne von uns aus
anscheinend hinter der Erde;
nur die uns entgegengesetzt liegende untere Hälfte der Erdkugel
ist beleuchtet und der Schatten der Erde ragt über uns wie ein
ausgestreckter Arm senkrecht oder schräg aufwärts in den
Weltenraum hinein. Wie weit sich der Schatten erstreckt, wissen
wir aus unserer Kenntnis der Mondfinsternisse. Etwas anderes als
es die Mondfinsternis im großen ist, ist nun das Verschwinden
einer helleuchtenden Sternschnuppe auch nicht, denn da sie kein eigenes
Licht aussendet und nur im reflektierten Sonnenlicht leuchten kann,
muß sie für uns unsichtbar werden, sobald sie auf ihrem
Laufe in den Erdschatten eintritt, und ebenso sicher muß sie
plötzlich aufleuchten, wenn sie aus dem Erdschatten
austritt. So können wir unter Umständen dieselbe
Sternschnuppe verschwinden und wieder aufleuchten sehen, wenn ihre
Bahnlage es gestattet; sie kann aber auch in vollstem Glanze in den
Schatten eintreten und nicht wieder sichtbar werden, wenn ihre Bahn in
der Richtung des Schattens weiter läuft oder wenn der Austritt an
einer Stelle stattfindet, an der sie ohnehin wegen der
Undurchsichtigkeit des Horizonts nicht mehr sichtbar wäre.
In dieser durchaus jeden Zwangsmittels entbehrenden Weise erklären
sich die Erscheinungen in einfacher natürlicher Art und es
dürfte nicht viel Phantasie dazu gehören, die Sternschnuppen
des geheimnisvollen Wesens zu entkleiden, in dem sie uns nach den
bisherigen Erklärungsversuchen vorschweben mußten.
Es könnte uns entgegen
gehalten werden, daß nach für
einwandfrei gehaltenen Beobachtungen Sternschnuppen auch im Erdschatten
leuchtend gesehen sind. Es dürfte als Erklärung ein
Hinweis auf den sogenannten Plehnschen Refraktionsschatten - s.
Hauptwerk "Glazialkosmogonie" S. 212 und 213 - genügen, auf deren
nähere Begründung wir jedoch verzichten, um die Frage nicht
durch Hineintragen von Nebenerscheinungen zu verwirren. Dagegen
möchten wir einen Gedanken, der von Dr. Lösner im
"Schlüssel zum Weltgeschehen" 1927, ausgesprochen wurde, doch zur
Diskussion stellen. Nach ihm sollen feste, eine dünne
Gashülle tragende Körper in Erdnähe aufleuchten, wenn
sie elektrische Felder hoher Spannung durchlaufen, ähnlich wie
Geißlersche Röhren im Bereich der Tesla-Wellen zu leuchten
beginnen. Daß dieser Vorgang auch im Erdschatten zustande
kommen kann, ist ohne weiteres klar und es ist möglich, daß
derartige Erscheinungen für Sternschnuppen gehalten wurden, die
sie aber nicht sind.

(Bildquelle und -text: Buch
"Rhythmus des kosmischen
Lebens" von Hanns Fischer, 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
Figur
I: Lage des
Erdschattens für nächtlichen Beobachter am
Äquator bei Tag- und Nachtgleichen. Von links nach rechts: 8
Uhr abends; 10 Uhr abends; 12 Uhr nachts; 2 Uhr nachts; 4 Uhr
morgens. D = Dämmerungskeil. Schnuppen zeigen trotz
scheinbarer Regellosigkeit gewisse Hauptrichtungen; nur in den hellen
Bezirken im zurückgestrahlten Sonnenlicht sichtbar. Um
Mitternacht in den Tropen im Zenit keine Schnuppen.
Vormitternacht sind im Osten, nachmitternacht im Westen mehr Schnuppen
sichtbar als auf der Gegenseite. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)
Auf der obigen Figur I sind die
verschiedenen Lagen des Erdschattens
und nach bestimmten Erwägungen gezeichnete Hauptrichtungen von
Sternschnuppenbahnen dargestellt; aus Figur II ist ersichtlich, wie
verschieden die Sternschnuppen erleuchtet sein können, so
daß sie je nach der Phasenlage und der sich daraus ergebenden
Helligkeit verschieden groß erscheinen, obwohl z. B. die
Körper c und c¹ sonst von gleicher Größe
sind. Es ist auch gezeigt, daß eine große Schnuppe a
in bedeutenderer Entfernung nicht größer aussieht als eine
kleine b, die an der Erde näher vorbeizieht. Der als
Dämmerungs- oder Dunstkeil angedeutete Abschnitt D deutet die
Höhe über dem Horizont des Beobachters an, in der die
Undurchsichtigkeit der Luft in der Regel so stark ist, daß keine
Sterne und Sternschnuppen mehr erblickt werden können.

(Bildquelle und -text: Buch
"Rhythmus des kosmischen
Lebens" von Hanns Fischer, 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
Figur
II: Sternschnuppen
sind entweder nur aus Eis bestehende Körper oder auf der
Oberfläche vereiste Meteore. Sie leuchten im
zurückgeworfenen Sonnenlicht weit außerhalb unserer
Lufthülle, sofern sie groß genug sind, auf der Netzhaut
einen Lichteindruck hervorzurufen. Demgemäß
können Sternschnuppen weder im Erdschatten C, noch im
Dunstkeilring D sichtbar sein, sondern nur in den hell gehaltenen,
sonnenlicht-durchfluteten Weltraumgebieten. a, b, c, c¹ =
Sternschnuppen. Dringen diese in die irdische Lufthülle ein,
so erwärmen sie sich und erzeugen Hagel oder Regen.
Einschießende Meteore erhitzen sich bis zur Weißglut und
zerbersten. (Zeichnung von Hörbiger.)
Die Figur III 1 bis III 3
zeigen die Lage des Erdschattens in unseren
Breiten zu verschiedenen Jahreszeiten und den davon abhängigen
mehr oder weniger großen, dem Blick zugänglichen freien
Himmelsraum; es ist auch der Vorgang des Verschwindens einzelner
Sternschnuppen im Erdschatten daraus zu erkennen.

(Bildquelle und -text: Buch
"Rhythmus des kosmischen
Lebens" von Hanns Fischer, 1925, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
Figur
III:
1) Die Lage des Erdschattens in unseren Breiten am 21. Dezember um Mitternacht. Da das Gebiet über dem Beobachter zum Teil von Schatten bedeckt ist, können nur wenig Sternschnuppen beobachtet werden. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)
2) Die Lage des Erdschattens in unseren Breiten am 21. März und 21. September um Mitternacht. Da der Westhimmel zum weitaus größten Teile schattenfrei ist, so können zahlreiche Sternschnuppen beobachtet werden. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)
3) Die Lage des Erdschattens in unseren Breiten am 21. Juni um Mitternacht. Schnuppen werden trotzdem selten beobachtet, weil die Nachtzeit zu kurz und die Nächte zu hell sind und weil Eislinge erst von Juli bis Dezember im Jahresablauf die Erdbahn kreuzen. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)
1) Die Lage des Erdschattens in unseren Breiten am 21. Dezember um Mitternacht. Da das Gebiet über dem Beobachter zum Teil von Schatten bedeckt ist, können nur wenig Sternschnuppen beobachtet werden. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)
2) Die Lage des Erdschattens in unseren Breiten am 21. März und 21. September um Mitternacht. Da der Westhimmel zum weitaus größten Teile schattenfrei ist, so können zahlreiche Sternschnuppen beobachtet werden. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)
3) Die Lage des Erdschattens in unseren Breiten am 21. Juni um Mitternacht. Schnuppen werden trotzdem selten beobachtet, weil die Nachtzeit zu kurz und die Nächte zu hell sind und weil Eislinge erst von Juli bis Dezember im Jahresablauf die Erdbahn kreuzen. (Zeichnung von Hanns Hörbiger.)
Jetzt könnte
höchstens noch die Frage gestellt werden: Woher
wissen wir denn aber, daß die Körper, die so im Sonnenlicht
leuchten, aus Eis bestehen?
Diese Frage können wir nun beantworten, sobald wir den Weg einer Sternschnuppe weiter verfolgen. Unter den zahllosen Kleinkörpern, die aus dem Weltall zur Sonne streben, gibt es, wie wir gesehen haben, immer einige, die auf ihrem Wege der Erde so nahe kommen, daß sie zu ihr herangezogen werden, und so kommt auch von den Sternschnuppen, die wir leuchtend dahinfliegen sahen, manch eine doch in den Anziehungsbereich der Erde.
Ein Meteor mit festem Kern werden wir unter geeigneten Verhältnissen zweimal als leuchtenden Körper sehen; einmal, solange es noch einen Eismantel hat, als richtige Sternschnuppe außerhalb der Atmosphäre, und dann nach dem Eintritt in diese als einen durch Reibung erhitzten Körper. Eine Eissternschnuppe mag vielleicht in den höchsten, allerdünnsten Schichten des Luftmantels noch im Sonnenlicht leuchten können, sobald sie jedoch tangential vordringend in tiefere und dichtere Schichten gelangt, wird sie sich ebenfalls erwärmen, aber nicht in Glühhitze geraten können; sie muß zerfallen, in Dampf- und Wolkenform übergehen und wird sich durch Hagelschlag oder irgendeine andere Erscheinungsart der Wetterkatastrophen bemerkbar machen.
Und wenn wir solches Hageleis noch stunden-, ja tagelang daliegen sehen und fühlen können, wie kalt es ist, ja noch schauernd an die plötzlich hereingebrochenen Sturm- und Wettererscheinungen denken müssen, dann wird es uns auch klar, daß wir es mit der Auflösung eines kosmischen Eiskörpers zu tun hatten, der uns vielleicht einen halben Tag vorher noch am Himmel als Sternschnuppe erschien, bei deren Aufleuchten manches sehnsüchtige Gemüt sich sogar noch etwas recht Gutes gewünscht haben mag.
Diese Frage können wir nun beantworten, sobald wir den Weg einer Sternschnuppe weiter verfolgen. Unter den zahllosen Kleinkörpern, die aus dem Weltall zur Sonne streben, gibt es, wie wir gesehen haben, immer einige, die auf ihrem Wege der Erde so nahe kommen, daß sie zu ihr herangezogen werden, und so kommt auch von den Sternschnuppen, die wir leuchtend dahinfliegen sahen, manch eine doch in den Anziehungsbereich der Erde.
Ein Meteor mit festem Kern werden wir unter geeigneten Verhältnissen zweimal als leuchtenden Körper sehen; einmal, solange es noch einen Eismantel hat, als richtige Sternschnuppe außerhalb der Atmosphäre, und dann nach dem Eintritt in diese als einen durch Reibung erhitzten Körper. Eine Eissternschnuppe mag vielleicht in den höchsten, allerdünnsten Schichten des Luftmantels noch im Sonnenlicht leuchten können, sobald sie jedoch tangential vordringend in tiefere und dichtere Schichten gelangt, wird sie sich ebenfalls erwärmen, aber nicht in Glühhitze geraten können; sie muß zerfallen, in Dampf- und Wolkenform übergehen und wird sich durch Hagelschlag oder irgendeine andere Erscheinungsart der Wetterkatastrophen bemerkbar machen.
Und wenn wir solches Hageleis noch stunden-, ja tagelang daliegen sehen und fühlen können, wie kalt es ist, ja noch schauernd an die plötzlich hereingebrochenen Sturm- und Wettererscheinungen denken müssen, dann wird es uns auch klar, daß wir es mit der Auflösung eines kosmischen Eiskörpers zu tun hatten, der uns vielleicht einen halben Tag vorher noch am Himmel als Sternschnuppe erschien, bei deren Aufleuchten manches sehnsüchtige Gemüt sich sogar noch etwas recht Gutes gewünscht haben mag.
Nun gut! mag es heißen;
daß einzelne Sternschnuppen
gelegentlich als Hagel zur Erde gelangen, möge gelten; wie aber
ist es zu erklären, daß ganze Schwärme dieser
himmlischen Eisgeschosse auftreten? Dann müßten im
Zusammenhang damit in solcher Zeit oder doch nicht zu lange danach auch
große Wassermassen zur Erde niedergehen, und da sich dieses
Vorkommnis seit Jahrtausenden alljährlich mehrmals wiederholte, so
könnte doch der dadurch eingetretene Überfluß an Wasser
auf die Dauer nicht unbemerkt geblieben sein!
Dieser ganz richtige Gedankengang führt uns zu einer interessanten Erweiterung der Ausführungen über die Rolle, welche den Sternschnuppen für die Erde selbst zufällt.
Das Wasserquantum der Erde, bestehend aus dem Inhalt aller Weltmeere, Binnenmeere und der Landseen, ist, da die Tiefen der einzelnen Gewässer ziemlich genau bekannt sind, mit einiger Sicherheit festzustellen. Könnte man die berechnete Wassermenge in gleichmäßiger Stärke auf einer glatten Kugel von der Größe der Erde verteilen, so würde diese bei einem Durchmesser von 12 500 km einen Wassermantel von 2,7 bis 3 km Tiefe erhalten. Eine richtige Vorstellung von diesen Verhältnissen kann man sich nicht gut machen, weil der Vergleichsmaßstab fehlt; deutlicher werden sie jedoch, wenn wir versuchen, in einem großen Raume die Erde als Kreis von 12,5 m Durchmesser auf den Boden zu zeichnen; dann würde die entsprechend aufgetragene Wassertiefe nur 3 mm betragen! Das ist ungefähr die Dicke des Strichs, den man bei dem Ziehen dieses Kreises mit einem Zimmermannsbleistift bekommt!
So wenig Wasser soll auf der Erde sein? wird die erstaunte Frage lauten; aber es ist so und es ist ganz lehrreich, sich an solchem Beispiel die Antwort auf eine Frage zu holen, an der man sonst gedankenlos vorbeigeht, indem man wunder welche Vorstellungen von den gewaltigen Wassermassen der Ozeane hat. Nun ist die Lehrmeinung der Meteorologie: Das Wasser der Erde bleibt seiner Menge nach immer unverändert; was die Sonne an der einen Stelle verdunstet und in Dampfform zu Wolken macht, kommt in Form von Tau, Schnee, Regen, Hagel wieder zurück; es schlägt sich an den Gebirgen nieder, fließt durch die Flüsse ins Meer, steigt wieder als Wolken auf, um als Niederschlag in irgendwelcher Form seinen ewigen Kreislauf ständig zu erneuern. Die Sache wäre überaus einleuchtend, wenn dieser Schluß richtig wäre! Er ist es aber nicht. Die Erde verliert im Gegenteil ständig von ihrem Wasservorrat, der im Laufe der Jahrmillionen wohl schon aufgezehrt sein müßte, wenn es keinen Ersatz dafür gäbe. Die Ursachen dieser Verluste sind verschiedener Art. Um nur die wichtigsten anzuführen, ist festzustellen: erstens versickert ständig Wasser in Tiefen der Erdkruste, aus denen es nie wieder durch Erwärmung in Folge der Sonnenbestrahlung in Dampfform herausgeholt werden kann. Zweitens geht viel Wasser in Innern der Erde und auch an ihrer Oberfläche chemische Bindungen mit Mineralien ein; auch dieses Wasser ist verloren. Drittens dringt an Küsten vulkanischer Länderstrecken ständig Wasser durch Spalten bis zu den Glutherden der Vulkane vor; es zersetzt sich hier in seine Elemente, von denen der freie Wasserstoff sowohl bei den Eruptionen, als auch in ständigem Aushauchprozeß aus den Kratern und Schlünden der Vulkane die Erde verläßt und als das leichteste Gas bis in allerhöchsten Schichten der Atmosphäre hinaufsteigt, ja durch außerirdische Kräfte in den Weltraum selbst hinausgetragen wird; also auch dieser Bestandteil des Wassers entweicht für immer. Freier Wasserstoff könnte den Vulkanen aber nicht entströmen, wenn nicht vorher Wasser, welches zersetzt werden kann, dagewesen wäre; diese Verluste sind demnach nicht zu bestreiten und auch nicht zu vernachlässigen. Viertens ist ohne weiteres klar, daß auch auf dem Grunde des Meeres Wasser in die Erde selbst eingepreßt werden muß. Wir haben Ozeantiefen von über 9000 m, das entspricht einem Atmosphärendruck von 900 kg auf einen Quadratzentimeter. Solchem Druck würde der stärkste Dampfkessel nicht standhalten; welche Wassermengen auf diese Wiese dauernd in den Erdmantel hineingepreßt werden, entzieht sich jeder Vorstellung. Freilich tritt aus den Tiefen der Erde auch Wasser in Form von Quellen wieder an die Oberfläche; aber all das eingedrungene Wasser, welches nach Zersetzung oder chemischer Verbindung mit Mineralien nicht mehr als Wasser bezeichnet werden kann, ist und bleibt verloren, so daß die Behauptung, die Erde müßte bei diesen Verlusten schon längst eine sterile Wüste geworden sein, in vollem Umfange wahr ist. Und daß auch die andere Behauptung nicht zu kühn ist, nach der die Aufrechterhaltung des annähernden Gleichgewichts im Wasserhaushalt der Erde nur durch Zufluß aus dem Kosmos, durch die aus Wasser bestehenden Sternschnuppen sowie durch von der Sonne kommenden Feineis möglich ist, soll jetzt an einem überraschenden Beispiel bewiesen werden, welches zugleich die Lösung des sogenannten Nilrätsels bringt.
Dieser ganz richtige Gedankengang führt uns zu einer interessanten Erweiterung der Ausführungen über die Rolle, welche den Sternschnuppen für die Erde selbst zufällt.
Das Wasserquantum der Erde, bestehend aus dem Inhalt aller Weltmeere, Binnenmeere und der Landseen, ist, da die Tiefen der einzelnen Gewässer ziemlich genau bekannt sind, mit einiger Sicherheit festzustellen. Könnte man die berechnete Wassermenge in gleichmäßiger Stärke auf einer glatten Kugel von der Größe der Erde verteilen, so würde diese bei einem Durchmesser von 12 500 km einen Wassermantel von 2,7 bis 3 km Tiefe erhalten. Eine richtige Vorstellung von diesen Verhältnissen kann man sich nicht gut machen, weil der Vergleichsmaßstab fehlt; deutlicher werden sie jedoch, wenn wir versuchen, in einem großen Raume die Erde als Kreis von 12,5 m Durchmesser auf den Boden zu zeichnen; dann würde die entsprechend aufgetragene Wassertiefe nur 3 mm betragen! Das ist ungefähr die Dicke des Strichs, den man bei dem Ziehen dieses Kreises mit einem Zimmermannsbleistift bekommt!
So wenig Wasser soll auf der Erde sein? wird die erstaunte Frage lauten; aber es ist so und es ist ganz lehrreich, sich an solchem Beispiel die Antwort auf eine Frage zu holen, an der man sonst gedankenlos vorbeigeht, indem man wunder welche Vorstellungen von den gewaltigen Wassermassen der Ozeane hat. Nun ist die Lehrmeinung der Meteorologie: Das Wasser der Erde bleibt seiner Menge nach immer unverändert; was die Sonne an der einen Stelle verdunstet und in Dampfform zu Wolken macht, kommt in Form von Tau, Schnee, Regen, Hagel wieder zurück; es schlägt sich an den Gebirgen nieder, fließt durch die Flüsse ins Meer, steigt wieder als Wolken auf, um als Niederschlag in irgendwelcher Form seinen ewigen Kreislauf ständig zu erneuern. Die Sache wäre überaus einleuchtend, wenn dieser Schluß richtig wäre! Er ist es aber nicht. Die Erde verliert im Gegenteil ständig von ihrem Wasservorrat, der im Laufe der Jahrmillionen wohl schon aufgezehrt sein müßte, wenn es keinen Ersatz dafür gäbe. Die Ursachen dieser Verluste sind verschiedener Art. Um nur die wichtigsten anzuführen, ist festzustellen: erstens versickert ständig Wasser in Tiefen der Erdkruste, aus denen es nie wieder durch Erwärmung in Folge der Sonnenbestrahlung in Dampfform herausgeholt werden kann. Zweitens geht viel Wasser in Innern der Erde und auch an ihrer Oberfläche chemische Bindungen mit Mineralien ein; auch dieses Wasser ist verloren. Drittens dringt an Küsten vulkanischer Länderstrecken ständig Wasser durch Spalten bis zu den Glutherden der Vulkane vor; es zersetzt sich hier in seine Elemente, von denen der freie Wasserstoff sowohl bei den Eruptionen, als auch in ständigem Aushauchprozeß aus den Kratern und Schlünden der Vulkane die Erde verläßt und als das leichteste Gas bis in allerhöchsten Schichten der Atmosphäre hinaufsteigt, ja durch außerirdische Kräfte in den Weltraum selbst hinausgetragen wird; also auch dieser Bestandteil des Wassers entweicht für immer. Freier Wasserstoff könnte den Vulkanen aber nicht entströmen, wenn nicht vorher Wasser, welches zersetzt werden kann, dagewesen wäre; diese Verluste sind demnach nicht zu bestreiten und auch nicht zu vernachlässigen. Viertens ist ohne weiteres klar, daß auch auf dem Grunde des Meeres Wasser in die Erde selbst eingepreßt werden muß. Wir haben Ozeantiefen von über 9000 m, das entspricht einem Atmosphärendruck von 900 kg auf einen Quadratzentimeter. Solchem Druck würde der stärkste Dampfkessel nicht standhalten; welche Wassermengen auf diese Wiese dauernd in den Erdmantel hineingepreßt werden, entzieht sich jeder Vorstellung. Freilich tritt aus den Tiefen der Erde auch Wasser in Form von Quellen wieder an die Oberfläche; aber all das eingedrungene Wasser, welches nach Zersetzung oder chemischer Verbindung mit Mineralien nicht mehr als Wasser bezeichnet werden kann, ist und bleibt verloren, so daß die Behauptung, die Erde müßte bei diesen Verlusten schon längst eine sterile Wüste geworden sein, in vollem Umfange wahr ist. Und daß auch die andere Behauptung nicht zu kühn ist, nach der die Aufrechterhaltung des annähernden Gleichgewichts im Wasserhaushalt der Erde nur durch Zufluß aus dem Kosmos, durch die aus Wasser bestehenden Sternschnuppen sowie durch von der Sonne kommenden Feineis möglich ist, soll jetzt an einem überraschenden Beispiel bewiesen werden, welches zugleich die Lösung des sogenannten Nilrätsels bringt.
Kein Strom der Erde hat durch
die Ereignisse, welche sich seit der
Urzeit des Menschengeschlechts an seinen Ufern abgespielt haben, eine
solche Berühmtheit erhalten wie der Nil. Über keinen
anderen Fluß sind uns auch seit dem grauen Altertum so viele
Angaben über Pegelstand, Zeiten des Steigens und Fallens des
Wassers, welche jetzt noch vollen Wert haben, erhalten geblieben; kein
anderer Fluß hat das Interesse der Forscher von alters her so
stark in Anspruch genommen, wie gerade der Nil mit seinem dunklen
Quellgebiet. Erst unseren Zeiten blieb es vorbehalten, die
Quellen des Stroms einwandfrei festzustellen; sie liegen zum Teil im
abessinischen Hochland in einer geographischen Breite von 9-16 Grad
nördlich vom Äquator, zum Teil am Äquator selbst und in
den sogenannten Nilseen (s. Figur IV.).

(Bildquelle und -text:
Aus dem Atlas zu dem Buch "Eis ein Weltenbaustoff von Heinrich Voigt,
Tafel II, 1929, R. Voigtländers Verlag-Leipzig.)
Figur
IV: Der blaue (a) und
der weiße (b) Nil vereinigen sich bei Khartum. Die
sogenannte "Nilschwelle",
welche im September beginnt und bis Oktober dauert, hat ihre Grund in
den während des Juli und August im abessinischen Hochland
fallenden großen Regenmengen, welche im engsten Zusammenhange mit
den Sternschnuppenfällen stehen.
Den letzteren entspringt der weiße
Nil b, dem ersteren der blaue
Nil a, dem noch der Atbara, welcher ebenfalls aus Abessinien kommt,
hinzuzurechnen ist. Der weiße Nil zeigt bei Dueim im
August/September sein Jahresminimum, während der blaue Nil zur
gleichen Jahreszeit sein plötzlich emporschnellendes Maximum
aufweist, und da sich das seit Jahrtausenden so regelmäßig
wiederholt, daß die ganze ägyptische Landwirtschaft darauf
eingestellt ist, so muß es einen feststellbaren Grund
haben. Hören wir, was darüber berichtet wird: "Wie die
Dinge wirklich liegen, haben erst die genauen Beobachtungen gelehrt,
die im Auftrage der Landesaufnahme von Baron, Beadnell und Hume von Mai
1902 bis Januar 1904 in einiger Entfernung vom Zusammenfluß
beider Nilarme angestellt wurden: am blauen
Nil 5 km oberhalb Khartum, am weißen Nil 320 km oberhalb
der Stromvereinigung, bei Dueim. Da ergab sich klar die
Beherrschung der Nilhochflut durch den blauen
Nil und den Atbara, die Gewässer des abessinischen
Hochlandes. Die rasch heranziehende Hochwasserwelle des blauen Nils, quer durch das Bett des
Hauptstromes gegen dessen linkes Ufer andringend, verschließt dem
weißen Nil derartig
den Abfluß, daß er zurückgestaut weit über die
Ufer tritt. Nur durch seine passive Rolle, durch die
Beschränkung des Abflusses, gelangt er auf einer dünnen
Oberflächenschicht zu einer erstaunlichen, erst hier sich
ansammelnden Wasserfülle, die dann nachträglich, wenn der
blaue Nil wieder gefallen ist, allmählich zum Abfluß
kommt. Gerade wenn der Scheitel der Hochwasserwelle des blauen Nils an Khartum
vorüberzog, war der Beitrag des weißen
Nils ganz unbedeutend, 1903 nur einzwölftel, 1902 gar nur
einzwanzigstel der Wasserfülle des blauen, und erst nach Ablauf der
Hochwasserzeit Ende November oder Anfang Dezember begann für den
Niederwasserstand bezeichnende Überlegenheit des weißen Nils
sich wieder herzustellen." Dieses in solcher Entschiedenheit
nimmermehr erwartete Ergebnis kommt nachdrücklicher als in langen
Tabellen und Schilderungen in der graphischen Darstellung von Lyons zum
Ausdrucke. In aller Schärfe spricht Lyons aus, "daß
nur das abessinische Hochland verantwortlich ist für die Speisung
der Nilhochflut, und der Regenfall im Becken des weißen Nils bei
deren Würdigung ganz außer Betracht bleiben kann." Im
Lichte dieser neuesten Aufklärung wird es verständlich,
daß die Sendboten Alexanders, die Gewährsmänner des
Aristoteles, durch den besonderen Zweck ihrer Reisen dazu geführt
wurden, unter dem überwältigenden Eindruck der Hochflut des blauen Nils diesen als den
Hauptquellfluß anzusehen, den in dieser Jahreszeit aber ganz zu
einer Nebenquelle herabsinkenden weißen
Nil anscheinend gar nicht besonders zu beachten. Nur ganz
hypothetisch knüpft Aristoteles einen westlichen Quellarm des Nils
an das afrikanische Silbergebirge. Aristoteles hat in einem uns
erhalten gebliebenen Werke seine Ansicht über die Nilschwelle
ausgesprochen, indem er sagt: "Geradezu sichtbar ist es, daß in
Äthiopien um diese Zeit von den Hundstagen bis zum Arktur
zahlreiche und ausgiebige Regen fallen, im Winter aber keine. Und
in diesen Regen finden die Hochfluten, während sie anschwellen,
ihre Nahrung. Und deswegen trifft der Fluß ( d. h. der
angeschwollene) zugleich mit den Etesien (das sind die nördlichen
Sommerwinde Griechenlands) ein; denn sie sind es, die das Gewölk
in jene Gegend treiben." Freilich verwechselt er hier Wirkung und
Ursache, denn die Stürme sind nach unserer Auffassung erst die
Folge der kosmischen Störungen, aber er vertritt doch eine andere
sehr richtige Anschauung, indem er bemerkt: "Bei Mondwechsel
fließt der Fluß kräftiger, denn da fallen die Regen
stärker." Mit dieser Bemerkung bestätigt Aristoteles
lange vor Falb, daß die Wetterverhältnisse in gewissem
Zusammenhang mit den Mondphasen stehen, und dieser Gedanke, in richtige
Bahnen gelenkt, muß mit
der Zeit die ihm auch für die sonstige praktische Meteorologie
zukommende Anerkennung finden.
Wir wollen jedoch an dieser
Stelle nur die Frage aufwerfen, aus welchem
Grunde gerade im August in jener Gegend so ausgiebige Regenmengen
fallen müssen; hiermit kann gleichzeitig eine Aufklärung
verbunden werden, die zeigt, daß der in den zwei Hauptzonen am
Äquator festzustellende stärkere Einfang kosmischer
Eiskörper als eine logische Folge der neuen Lehre erscheinen
muß.
Wenn auch Beispiele oft hinken,
so könnte das jetzt zu
beschreibende doch dazu dienen, die Vorstellung über den
physikalisch-mechanischen Vorgang beim Eiseinfang zu erleichtern: Man
denke sich ein Sieb, aus dessen Maschen mit Hilfe einer
Rührvorrichtung ständig ein feiner, gleichmäßiger
Regen von Eisenpfeilspänen zum Fallen gebracht wird, und unter
diesem Sieb ein Pendel schwingend, dessen unteres Ende einen Magneten
trägt. Jedes Pendel schwingt zwischen zwei Endlagen, in
denen es jeweils für eine kurze Zeit zur Ruhe kommt; von der einen
nimmt es seinen Weg über die Mittellage hinaus - in der es die
größte Geschwindigkeit erreicht - bis zur entgegengesetzten,
um hier wieder umzukehren. Es ist klar, daß der in Ruhe
oder nur noch in geringerer Geschwindigkeit befindliche Magnet von dem
an ihm vorbeifallenden Eisenregen in der Zeiteinheit eine
größere Menge anziehen wird als ihm möglich ist, wenn
er ihn in größerer Schnelligkeit in der Mittellage
durchschneidet. Vertauschen wir nun den Eisenregen mit dem zur
Sonne ziehenden Schwarm der Meteor- und Eiskörper und den Teil der
Erdoberfläche, der in gewissem Sinne unter der Sonne hin- und
herpendelt, mit dem Magnet, dann ergibt sich das folgende: Die Erde
umläuft mit ihrer schräg stehenden Drehachse die Sonne einmal
im Jahre, der Sonnenhochstand muß sich deshalb im Laufe des
Jahres ständig zwischen zwei Grenzlagen ändern, die sich nach
dem Neigungswinkel der Erdachse bestimmen. Wie der aus einer
Ruhelage nach der anderen hinschwingende Magnet die Mittellage am
schnellsten durchläuft, so überquert die Sonne auch den
Erdäquator (in den Äquinoktien) mit größter
Geschwindigkeit, während sie sich den Wendekreisen (in den
Solstitien) in ständig abnehmender Geschwindigkeit nähert und
sie nach einem gewissen Stillstand auch nur mit langsam wachsender
wieder verläßt. Die Breiten der Wendekreise haben
deshalb Zeit und Gelegenheit, eine größere Menge sowohl von
dem zur Sonne strebenden Grobeis als auch von dem ihr
entströmenden Feineis aufzufangen. Da nun der
Sonnenhochstand täglich alle Punkte des betreffenden Breitengrades
unter sich hat, so schmiegt sich das kosmische Eis - Grobeiskörper
und sonnenflüchtiges Feineis - dem Weg der Sonne an und zwar vom
nördlichen Wendekreis nach dem Äquator zu in abnehmender, von
da ab bis zum anderen Wendekreis wieder in zunehmender Dichte (s. Figur
V.)

(Bildquelle und -text:
Aus dem
Atlas zu dem Buch "Eis ein Weltenbaustoff von Heinrich Voigt, Tafel II,
1929, R. Voigtländers Verlag-Leipzig.)
Figur
V: Geographische
Übersicht der Niederschlagsgebiete der tropischen Ströme samt
deren klimatische Verschiedenheit, wie sie insbesondere für Kongo,
Nil, Panama und Vorderindien bestehen: Die afrika-arabische
Wüstenluftsäule als atmosphärisches Regenwasserbecken im
Juni-Juli-August für Indien und Abessinien im Licht der WEL.
Nehmen wir einen Globus zur
Hand, auf dem auch die Sturmgebiete
vermerkt sind, so finden wir nördlich und südlich vom
Äquator das Auftreten der Passatwinde wie zwei um die Erde
laufende Gürtel angedeutet, während dazwischen gerade am
Äquator die Zone der sogenannten Kalmen, der Ruhe, liegt.
Dieses Bild deckt sich genau mit der Lage der Gürtel, in denen der
Eiseinfang stattfindet, und der Vergleich der unter der Sonne hin- und
herschwingenden Breitengrade der Erdkugel mit dem pendelnden Magnet
wird jetzt vielleicht klar. Die Wirkung der Sonne kann aber durch
geeignete Mondstellungen noch gesteigert werden. Wir wissen,
daß die Flut des Meeres höher steigt, wenn der Mond zwischen
Erde und Sonne steht, so daß sich die anziehende Kraft beider
Gestirne summiert, und diesen Flutzustand nennen wir Springflut.
Herrscht nun gerade Neumond, dann verstärkt der Mond die
Einwirkung der Sonne; auch er befördert das Heranlenken der
Eiskörper und des Feineises zur Erde, und das ist die Beobachtung,
die schon Aristoteles gemacht hat, daß nämlich "bei
Mondwechsel die Regen stärker fallen" (s. Figur VI.)
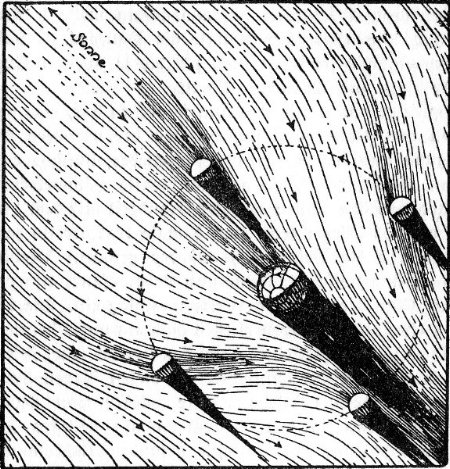
(Bild- u.. Textquelle:
Buch "Der Weg ins
Unbetretene" von Hanns Fischer, 1935, Dr. Hermann Eschenhagen/Breslau)
Figur VI: Erd und Mond.
Links oben ist die Sonne zu denken. Vom Gebiete des Polarsternes
aus gesehen, sind die einzelnen Mondphasen sichtbar.
Nach dieser Darlegung kehren
wir zum Nil zurück.
Die Sonne hat am 21. Juni ihren Rückzug vom nördlichen Wendekreis, der 23 Grad über dem Äquator liegt, angetreten und durchläuft während des August die Zone von 18-8 Grad nördlicher Breite. Wir haben bereits gehört, daß die Quellgebiete des blauen Nils zwischen dem 16. und dem 9. Breitengrade liegen, welche nach den vorhergegangenen Ausführungen gerade in diesem Zeitabschnitt als im Einfanggebiet der Eiskörper gelegen anzusehen sind. Das kosmische Eis muß sich unter den Tropen vornehmlich in Form von Regen geltend machen, und die Ursache der Nilschwelle würde schon hierdurch als aufgeklärt gelten können. Sie wird aber vollkommen klargestellt, wenn wir die Figuren VII, V und VIII etwas genauer ansehen und sie mit der Kurve des Nilpegelstandes in Fig. VIII in Zusammenhang bringen.
Die Sonne hat am 21. Juni ihren Rückzug vom nördlichen Wendekreis, der 23 Grad über dem Äquator liegt, angetreten und durchläuft während des August die Zone von 18-8 Grad nördlicher Breite. Wir haben bereits gehört, daß die Quellgebiete des blauen Nils zwischen dem 16. und dem 9. Breitengrade liegen, welche nach den vorhergegangenen Ausführungen gerade in diesem Zeitabschnitt als im Einfanggebiet der Eiskörper gelegen anzusehen sind. Das kosmische Eis muß sich unter den Tropen vornehmlich in Form von Regen geltend machen, und die Ursache der Nilschwelle würde schon hierdurch als aufgeklärt gelten können. Sie wird aber vollkommen klargestellt, wenn wir die Figuren VII, V und VIII etwas genauer ansehen und sie mit der Kurve des Nilpegelstandes in Fig. VIII in Zusammenhang bringen.
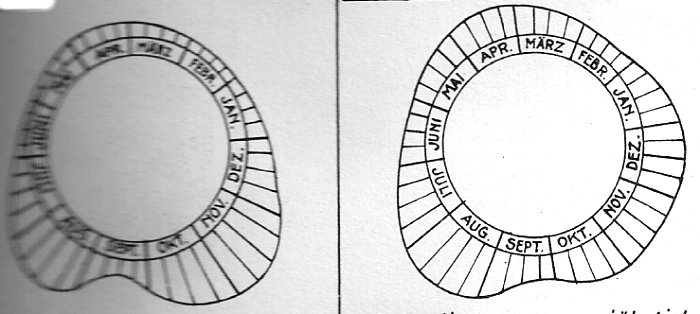
(Bildquelle u. -text: Aus dem
Atlas zu dem Buch "Eis ein Weltenbaustoff von Heinrich Voigt, Tafel II,
1929, R. Voigtländers Verlag-Leipzig.)
Figur
VII: linkes
Polardiagramm der jährlichen Variation der historisch
berühmten Sternschnuppenschwärme; rechtes Polardiagramm der
jährlichen Variation der sporadischen (einzelnen)
Sternschnuppen. Man beachte bei beiden die Einsattelung im
September.
Es ist eine Verwandtschaft zwischen beiden Kurven vorhanden, die sich in dem Anstieg im August, dem darauf folgenden Abfall im September und neuen aber schwächeren Anstieg im November andeutet. Die Erklärung hierfür sind die meteorologischen Einflüsse des Grobeises auf die Erde.
Es ist eine Verwandtschaft zwischen beiden Kurven vorhanden, die sich in dem Anstieg im August, dem darauf folgenden Abfall im September und neuen aber schwächeren Anstieg im November andeutet. Die Erklärung hierfür sind die meteorologischen Einflüsse des Grobeises auf die Erde.

(Bildquelle und -text:
Aus dem
Atlas zu dem Buch "Eis ein Weltenbaustoff von Heinrich Voigt, Tafel II,
1929, R. Voigtländers Verlag-Leipzig.)
Figur VIII: Zusammenhang
des Nilpegelstandes mit den Sternschnuppen. a-Kurve der Anzahl der
während eines Jahres unter dem nördlichen Wendekreis
beobachteten Sternschnuppen (nach Fritz). b-Nilpegelstand bei
Kairo. Bis das Wasser von Khartum nach Kairo gelangt, vergehen
ca. 2 Monate.
Sowohl die Polardiagramme der
Fig. VII, die die Zahlen der in den
periodischen Sternschnuppenschwärmen seit fast 2000 Jahren
gezählten, wie der einzeln auftretenden Schnuppen als verschieden
lange Radien zeigen, als auch die Kurve a in Fig. VIII lassen
übereinstimmend ein Ansteigen der Schnuppenzahlen im Juli und
August erkennen, dem ein Abfall im September folgt (s. hierzu "vom Welteis
umflutet").
Daß der Höhepunkt der Nilschwelle erst einige Wochen später am Pegel von Kairo eintritt, erklärt sich aus dem langen Wege, den das Wasser von den Niederschlagsgebieten aus zurückzulegen hat, und nur bei einem Strom, dessen ganzer Lauf fast gradlinig von Süden nach Norden gerichtet ist, kann diese Erscheinung so klar zutage treten. Ein Blick auf die kleine Karte Fig. V zeigt, daß auf der ganzen Erde kein Fluß von Bedeutung zwischen den Wendekreisen vorhanden ist, der ein ähnliches Verhalten zeigen könnte. Aus dieser Karte wird vielleicht auch für manchen der Vergleich mit dem pendelnden Magnet klarer, denn die vertikale Tabelle zwischen Afrika und Amerika zeigt Ab- und Zunahme der Länge des Aufenthaltes der Sonne zwischen beiden Endpunkten ihres Weges.
Das ganze Problem ist in ausführlicher Weise von Hörbiger in dem Aufsatz "Das Rätsel der Nilhochflut und indischen Regenzeit, deren einheitliche Ursache im Lichte der Welteislehre" der Zeitschrift der Schlüssel zum Weltgeschehen 1925, Heft 2, S. 76 u. f. behandelt. Jedem, der sich für diese Frage interessiert muß diese Arbeit aufs wärmste empfohlen werden.
Daß der Höhepunkt der Nilschwelle erst einige Wochen später am Pegel von Kairo eintritt, erklärt sich aus dem langen Wege, den das Wasser von den Niederschlagsgebieten aus zurückzulegen hat, und nur bei einem Strom, dessen ganzer Lauf fast gradlinig von Süden nach Norden gerichtet ist, kann diese Erscheinung so klar zutage treten. Ein Blick auf die kleine Karte Fig. V zeigt, daß auf der ganzen Erde kein Fluß von Bedeutung zwischen den Wendekreisen vorhanden ist, der ein ähnliches Verhalten zeigen könnte. Aus dieser Karte wird vielleicht auch für manchen der Vergleich mit dem pendelnden Magnet klarer, denn die vertikale Tabelle zwischen Afrika und Amerika zeigt Ab- und Zunahme der Länge des Aufenthaltes der Sonne zwischen beiden Endpunkten ihres Weges.
Das ganze Problem ist in ausführlicher Weise von Hörbiger in dem Aufsatz "Das Rätsel der Nilhochflut und indischen Regenzeit, deren einheitliche Ursache im Lichte der Welteislehre" der Zeitschrift der Schlüssel zum Weltgeschehen 1925, Heft 2, S. 76 u. f. behandelt. Jedem, der sich für diese Frage interessiert muß diese Arbeit aufs wärmste empfohlen werden.
Konnte mit den vorstehenden
Darstellungen der Nachweis erbracht werden, daß die als
Eismeteore zu bezeichnenden Sternschnuppen eine nicht zu
vernachlässigende Rolle im irdischen Wasserhaushalt spielen, dann
soll damit nicht gesagt sein, daß die Welteislehre allen Hagel,
Regen und die täglichen Winde auf kosmische Einschüsse
zurückführen will. Was sie behauptet und dereinst, wenn
ihr einmal eine auf Grund ihrer Anschauungen arbeitende Wetterwarte zur
Verfügung stehen wird, sicher beweisen zu können glaubt, ist
das, daß neben dem normalen irdischen Wasserkreislauf kosmische
Einflüsse vorhanden sind, die sich besonders durch die
katastrophalen Wettererscheinungen bemerkbar machen. Es mutet wie
Vogelstraußpolitik an, wenn manche Forscher so tun, als wenn die
Berichte über das Auffinden kiloschwerer Eisstücke nach
schweren Hagelschlägen nicht ernst genommen zu werden brauchen,
nur um der Frage nach der Herkunft dieses Eises aus dem Wege zu gehen;
die Tatsache des Niedergangs
so großer Stücke wird doch in den meteorologischen
Lehrbüchern mit Angabe des Fundortes zugegeben, ebenso die
Schwierigkeit der Erklärung der Erscheinung mit den der
Wissenschaft jetzt zur Verfügung stehenden Mitteln. Konnte
die Forschung ihren Irrtum betr. der metallisch-mineralischen Meteore
zugeben, ohne an Ansehen einzubüßen, dann könnte sie
doch ebensogut von den bisher unerklärbaren großen
Eisstücken ausgehend auf kosmische größere
Eiskörper schließen, denen die Trümmerstücke
entstammen müssen. Dies als richtig erkannt, wäre der
erste Schritt zu einer Neuaufrollung des ganzen Sternschnuppenproblems;
daß diese Frage dann im großen und ganzen im
Hörbigerschen Sinne beantwortet werden würde, ist für
uns zweifellos. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre arbeitet
die Zeit merklich im Sinne der Welteislehre, hat doch die Forschung
gerade schon eine andere unserer grundlegenden Behauptungen auf diesem
Gebiete bestätigt, ohne allerdings die weiteren Schlüsse
daraus zu ziehen: Hörbiger sagt, daß die Meteore und
Sternschnuppen wesensverschiedene Körper seien, diese hängen
mit einem bestimmten Teil des Himmels als Ausgangsort zusammen,
während jene von allen Seiten des Weltalls nach der Sonne
hinströmen, was nicht nur in den Bahnrichtungen, sondern auch in
anderen Erscheinungen zum Ausdruck kommen muß. Die Meinung
der Wissenschaft erkennen wir aus Newcomb-Engelmann, wo es auf S. 511
heißt: "Wie folgende Tabellen zeigen, fallen die meisten
Meteoriten zwischen Mittag und Mitternacht, also wenn der Antiapex
seine höchste Stellung hat, während das tägliche Maximum
der Sternschnuppenhäufigkeit dann eintritt, wenn der Apex
hochsteht, d. h. zwischen Mitternacht und Morgen. Ferner sind Mai
und Juni die an Meteoriten reichsten Monate, während die
Herbstmonate die größte Sternschnuppenzahl zeigen.
Diese von den Meteoriten befolgten Regeln gelten nach den
Untersuchungen von Nißls auch für die großen
Feuerkugeln. Noch größere Unterschiede bestehen
zwischen den kosmischen Bahnen der Sternschnuppen einerseits und der
Feuerkugeln und Meteoriten andrerseits........ Eine engere
Verwandtschaft zwischen letzteren und den Sternschnuppen dürfte
daher nach dem Stande unseres heutigen Wissens nicht bestehen."
Hiermit ist für uns die
Richtigkeit der Hörbigerschen Auffassung bestätigt; wann die
Wissenschaft für sich die Folgerungen aus der angeführten
Schriftstelle ziehen wird, berührt uns nicht, ebensowenig die
Wahrnehmung, daß Welteisgegner von solchen Ausführungen
nichts zu wissen scheinen, wenn es sich darum handelt, Hörbigers
Gedanken als unwissenschaftlich hinzustellen.
Es bliebe noch zu untersuchen, ob die Meteoriten und Sternschnuppen Zerfallprodukte früherer Kometen sein können, oder ob diese selbst etwa als Anhäufungen erstgenannter Körper angesehen werden müssen. Ehe eine Entscheidung hierüber getroffen oder versucht werden kann, erscheint es zweckmäßig, eine Vorstellung über das wirkliche Wesen dieser rätselhaftesten aller Himmelskörper zu gewinnen. Das ist aber sehr schwer, denn so viele uns von ihnen auch bekannt sind, so gibt es doch nicht zwei, die in allen Erscheinungen einander gleich wären. Der Einfachheit halber wollen wir unsere Betrachtung auf solche Kometen die dem freien Auge sichtbar waren, beschränken, und uns an ihnen über das Wesentliche dieser Gebilde unterrichten.
Es bliebe noch zu untersuchen, ob die Meteoriten und Sternschnuppen Zerfallprodukte früherer Kometen sein können, oder ob diese selbst etwa als Anhäufungen erstgenannter Körper angesehen werden müssen. Ehe eine Entscheidung hierüber getroffen oder versucht werden kann, erscheint es zweckmäßig, eine Vorstellung über das wirkliche Wesen dieser rätselhaftesten aller Himmelskörper zu gewinnen. Das ist aber sehr schwer, denn so viele uns von ihnen auch bekannt sind, so gibt es doch nicht zwei, die in allen Erscheinungen einander gleich wären. Der Einfachheit halber wollen wir unsere Betrachtung auf solche Kometen die dem freien Auge sichtbar waren, beschränken, und uns an ihnen über das Wesentliche dieser Gebilde unterrichten.
(s. weiterführenden
Aufsatz: "Über Kometen")
Dr. ing. h. c. Heinrich Voigt
(Buchquelle: "Eis - ein Weltenbaustoff" von Dr. ing. h. c. H. Voigt, S. 39-45, 3. Auflage, 1928, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)
ZUSATZ
....Nach Hörbiger sind die
Sternschnuppen Eiskörper, die in reflektiertem Sonnenlicht
leuchten. Ihre besonders große Zahl in der ersten
Augusthälfte erklärt sich aus dem Umstande, daß zu
dieser Zeit die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne die Wand des
Eisschleiertrichters schneidet, der ja aus zur Sonne fallenden
Eiskörpern besteht. Stürzen diese Körper in die
Sonne, so erzeugen sie die als Sonnenflecken,-fackeln und Protuberanzen
bekannten Erscheinungen, dringen sie in die Erdatmosphäre ein, so
zerplatzen sie und gehen als Hagel nieder. Auf diese Weise werden
alle charakteristischen Erscheinungen dieser Unwetter erklärt: die
kurze Dauer, das Niedergehen in langen schmalen Streifen, die damit
verbundenen Stürme usw. Man hat gegen diese Ableitungen
eingewendet, daß dann die einzelnen Hagelkörper eckig und
unregelmäßig gestaltet sein müßten, nicht etwa
rund, wie dies im Allgemeinen der Fall ist. Aber abgesehen davon,
daß durch Abschmelzen und Gefrieren sich die runde Gestalt der
Hagelkörner zwangslos erklärt, kommt auch
unregelmäßig gestalteter Hagel vor. Dies beweist z. B.
folgende Stelle aus H. von Wißmann (des späteren
Reichskommissars für Deutsch-Ostafrika) Reisewerk "Meine zweite
Durchquerung Äquatorialafrikas vom Kongo zum Zambesi während
der Jahre 1886 und 1887". Dort
heißt es: "Geradezu ein Phänomen fand am 14. August
statt. Schwarze Wolken türmten sich im Nordosten auf und
näherten sich mit überraschender
Schnelligkeit. Aus
derselben Richtung fuhr in sturmartigen
Stößen ein, wie es
uns schien, eiskalter
Wind über die von der
Mittagssonne heißgebrannte Savanne; das Thermometer sank von
33° auf 19° C, Bananen wurden niedergebrochen und im
benachbarten Dorfe viele Häuser abgedeckt. Dann, als das
drohende dunkle Gewölk über den Lulua herangezogen war,
fielen glasig
durchsichtige Eiskristalle,
meist in regelmäßigen
Würfeln von 1 bis 2 Zentimeter Seitenlänge prasselnd nieder, und Vieh und Menschen
suchten vor Schmerz schreiend Deckung. Sieben Minuten lang währte der Hagel, dessen
Stücke allmählich kleiner wurden, dann abgerundeter und
endlich weiß, den bei uns bekannten Graupeln vergleichbar.
Die Baschilange waren über diesen Vorgang ebenso erstaunt wie
wir...."
W. S.
(Aufsatzquelle: Monatheft "Schlüssel zum Weltgeschehen", aus dem Aufsatz: "Der Sternenhimmel im August 1928", Heft 8, S. 279-280, Jahrg. 1928, R. Voigtländers Verlag-Leipzig)