| Zurück |
Impressum
Datenschutz
Leseprobe zum
Manuskript
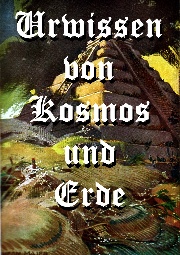
Kapitel I
Urwissen und Welteislehre
Von den Zeiten vor
Schöpfung der Welt, von dem Riesen Ymir, aus dessen Schädel
die Götter den Himmel bauten, von Sintflut, Erdenschöpfung
und Paradies und vom Ende aller Dinge, dem furchtbaren Sintbrand und
Kampf der Götter mit den Mächten der Finsternis erzählt
uns die Edda.
Aber sie steht mit ihrem Weltgebäude nicht vereinzelt da, denn fast die meisten Sagen der Kultur- und Naturvölker, wie auch die Bibel, wissen ähnliches zu berichten. Was sollte der Urgrund all dieser eigenartigen und doch so gewaltig packenden und ergreifenden Schilderungen sein?
Sollten Menschenhirne das ergrübelt haben oder sind es wirklich nur allegorische Darstellungen des Naturgeschehens, des Kampfes zwischen Licht und Finsternis, zwischen Sommer und Winter, ausgestattet mit höchster Phantasie, um dichterisch das Weltgeschehen zu schildern und zu begreifen?
Ohne Zweifel finden sich Anklänge, aber sie erklären vor allem nicht das Wichtigste. Oder sind Teile dieser Epen gar, wie Winkler annimmt, astronomischer Natur, die wie die Sintflut, Vorgänge am Himmel darstellen, um dann erst auf die Erde übertragen zu werden?
Aber sie steht mit ihrem Weltgebäude nicht vereinzelt da, denn fast die meisten Sagen der Kultur- und Naturvölker, wie auch die Bibel, wissen ähnliches zu berichten. Was sollte der Urgrund all dieser eigenartigen und doch so gewaltig packenden und ergreifenden Schilderungen sein?
Sollten Menschenhirne das ergrübelt haben oder sind es wirklich nur allegorische Darstellungen des Naturgeschehens, des Kampfes zwischen Licht und Finsternis, zwischen Sommer und Winter, ausgestattet mit höchster Phantasie, um dichterisch das Weltgeschehen zu schildern und zu begreifen?
Ohne Zweifel finden sich Anklänge, aber sie erklären vor allem nicht das Wichtigste. Oder sind Teile dieser Epen gar, wie Winkler annimmt, astronomischer Natur, die wie die Sintflut, Vorgänge am Himmel darstellen, um dann erst auf die Erde übertragen zu werden?
Wie hilflos man den Dingen noch
gegenübersteht, erhellt am besten die Erläuterung zur Voluspa
der Simrockschen Edda, herausgegeben von Neckel. "Der Dichter drückt nur soviel davon
aus (nämlich von der Weltschöpfung), wie er für seinen
Plan braucht; etliches läßt er weg, weil es diesen
stören würde, so die Schöpfung aus des Ymir Gliedern:
eine solche groteske Vorstellung, die im Zusammenhange der
Wafthrudnismal im Munde eines ungeschlachten Riesen sich gut ausnimmt,
würde in der Voluspa verletzen, weil mit der edel-erhabenen
Haltung der Seherin unvereinbar. Auch sonst schiebt dieser
Dichter die grotesken Elemente des Volksglaubens beiseite, oder er
bildet sie um zu edleren Vorstellungen, so wenn bei ihm der
Odinsrächer Widar dem Wolfe mit dem ritterlichen Schwerte das Herz
durchbohrt, statt ihm über den Zenit empor den Kiefer
aufzureißen."
Man fühlt die gleiche Ratlosigkeit, wenn Weiß und Heitmüller in der Einleitung zur Offenbarung Johannes über die Herkunft des Stoffes bemerken, daß auch die älteren Apokalyptiker nicht all diese Ideen erzeugt haben, sondern daß diese auf uraltem Volksglauben, uralten Vorstellungen fußen.
Man fühlt die gleiche Ratlosigkeit, wenn Weiß und Heitmüller in der Einleitung zur Offenbarung Johannes über die Herkunft des Stoffes bemerken, daß auch die älteren Apokalyptiker nicht all diese Ideen erzeugt haben, sondern daß diese auf uraltem Volksglauben, uralten Vorstellungen fußen.
Auf den bisher beschrittenen
Wegen kommen wir jedenfalls nicht weiter. Unsere heutige
Wissenschaft hat vor allem die Natursichtigkeit, die Verbindung mit der
fernen Vergangenheit, deren Denken und Fühlen sie nicht mehr
versteht, verloren. Ganz anders noch die Völker und Weisen
des geschichtlichen Altertums. Für sie stand es außer
Frage, daß hinter diesem "uralten Volksglauben" Realitäten
schlummerten, Dinge, von denen die Gegenwart infolge anderer kosmischer
Bedingungen keine Ahnung hat.
Die klarste und kürzeste Antwort auf all diese Fragen gibt uns die Edda selbst. In der Voluspa heißt es: "Ich will erzählen der Vorzeit Geschichten aus frühster Erinnerung." Die Geschichten und Ereignisse, die sie berichtet, stammen demnach aus früher Erlebtem, sind kein Mythus der Natur, keine bloße Phantasie, sondern Erinnerungen an eine urferne Vergangenheit, urgewaltige Vorgänge, die vom Menschengeschlecht denkend erlebt wurden.
Die klarste und kürzeste Antwort auf all diese Fragen gibt uns die Edda selbst. In der Voluspa heißt es: "Ich will erzählen der Vorzeit Geschichten aus frühster Erinnerung." Die Geschichten und Ereignisse, die sie berichtet, stammen demnach aus früher Erlebtem, sind kein Mythus der Natur, keine bloße Phantasie, sondern Erinnerungen an eine urferne Vergangenheit, urgewaltige Vorgänge, die vom Menschengeschlecht denkend erlebt wurden.
Sagt doch schon ein altes
Römerwort: Nihil est in intellectu, quod non fuerat in
sensu. Nichts ist im Verstande, was nicht (vorher) in den Sinnen
gewesen ist. Aus diesem Grunde ist auch das großartige
Geschehen in der Edda als wirklich erlebt aufzufassen, als ein Urwissen
von Dingen aus Urzeiten. Fragt doch die Voluspa eindringlich
mehrmals: "Wißt ihr davon?",
d. h. von Weltanfang und -ende?
Mimir, vor allem aber Odin soll alle Dinge kennen; denn "vor Weltentwicklung war Wodans Wissen". Auch die Riesen haben ein Urwissen; denn mehrmals mißt sich Wodan mit ihnen an Weisheit von Vergangenem und Künftigem. Darum heißen sie in der Edda "wissende Riesen" oder "an Weisheit gewandteste". Dasselbe gilt auch für die den Göttern verwandten Wanen.
Mimir, vor allem aber Odin soll alle Dinge kennen; denn "vor Weltentwicklung war Wodans Wissen". Auch die Riesen haben ein Urwissen; denn mehrmals mißt sich Wodan mit ihnen an Weisheit von Vergangenem und Künftigem. Darum heißen sie in der Edda "wissende Riesen" oder "an Weisheit gewandteste". Dasselbe gilt auch für die den Göttern verwandten Wanen.
Mit der Erkenntnis vom Urwissen
der Menschheit ist aber unsere Frage nur halb beantwortet; denn
irdische Kräfte, wenigstens die heute bekannten, reichen nicht
aus, um jene Zeugnisse der Vergangenheit auch nur halbwegs
verständlich zu machen. Läßt man dagegen die
Schilderungen von Weltschöpfung, Sintflut und dem alles
zerstörenden Sintbrand am geistigen Auge vorüberziehen, dann
ahnen wir kosmische Gewalten, die den Erdkörper umbrausten und
zerwühlten.
In seiner Welteislehre hat nun Hanns Hörbiger uns derartige Mächte enthüllt und uns damit einen Universalschlüssel in die Hand gegeben, dessen geradezu magische Kraft sich erst in Zukunft bewähren wird. Für uns kommt allerdings nur der Teil der Welteislehre in Frage, der als Leitfaden dienen soll, um die Beantwortung der anfangs gestellten Probleme zu ermöglichen.
Nach Hörbiger sind im Laufe geologischer Zeiträume besonders die Bahnen der kleineren Planeten und der Monde stärksten Veränderungen unterworfen. Das All ist nicht absolut leer anzunehmen, sondern von einer äußerst feinen Materie erfüllt zu denken, die im wesentlichen wohl aus Wasserstoff in unvorstellbarer Verdünnung besteht. Diese als feinste Bremse wirkende Materie (Weltraumwiderstand) verspürt naturgemäß der an Masse achtzigmal kleinere Mond bedeutend stärker als die Erde. Die Folge ist, daß er in seiner Bahn gebremst wird und im Laufe von Äonen sich langsam an uns heranschraubt. Ist das für die Zukunft der Fall, dann war er naturgemäß in Vorzeiten weiter von uns entfernt, ja, einmal so weit, daß er noch nicht der Schwerkraft der Erde unterlag, von ihr in seinem Lauf um die Sonne noch nicht eingefangen war, sondern noch als selbständiger Planet diese umkreiste. Und richten wir den Blick bis in die Fernen der ältesten geologischen Vergangenheit, dann kommen wir zu der überraschenden Tatsache, daß unser Planetensystem damals zahlreicher als heute war. So gab es im Sinne der WEL (Welteislehre) auch zwischen Erde und Mars in fernen Urtagen eine ganze Reihe kleiner selbständiger Planeten. Aber sie fielen alle dem Weltraumwiderstand zum Opfer, wurden nach und nach von der Erde eingefangen und gliederten sich schließlich dieser an.
Wichtig für unsere Betrachtung ist, daß Hörbiger den Mond von einem beträchtlich dicken Eispanzer bedeckt sieht.
In seiner Welteislehre hat nun Hanns Hörbiger uns derartige Mächte enthüllt und uns damit einen Universalschlüssel in die Hand gegeben, dessen geradezu magische Kraft sich erst in Zukunft bewähren wird. Für uns kommt allerdings nur der Teil der Welteislehre in Frage, der als Leitfaden dienen soll, um die Beantwortung der anfangs gestellten Probleme zu ermöglichen.
Nach Hörbiger sind im Laufe geologischer Zeiträume besonders die Bahnen der kleineren Planeten und der Monde stärksten Veränderungen unterworfen. Das All ist nicht absolut leer anzunehmen, sondern von einer äußerst feinen Materie erfüllt zu denken, die im wesentlichen wohl aus Wasserstoff in unvorstellbarer Verdünnung besteht. Diese als feinste Bremse wirkende Materie (Weltraumwiderstand) verspürt naturgemäß der an Masse achtzigmal kleinere Mond bedeutend stärker als die Erde. Die Folge ist, daß er in seiner Bahn gebremst wird und im Laufe von Äonen sich langsam an uns heranschraubt. Ist das für die Zukunft der Fall, dann war er naturgemäß in Vorzeiten weiter von uns entfernt, ja, einmal so weit, daß er noch nicht der Schwerkraft der Erde unterlag, von ihr in seinem Lauf um die Sonne noch nicht eingefangen war, sondern noch als selbständiger Planet diese umkreiste. Und richten wir den Blick bis in die Fernen der ältesten geologischen Vergangenheit, dann kommen wir zu der überraschenden Tatsache, daß unser Planetensystem damals zahlreicher als heute war. So gab es im Sinne der WEL (Welteislehre) auch zwischen Erde und Mars in fernen Urtagen eine ganze Reihe kleiner selbständiger Planeten. Aber sie fielen alle dem Weltraumwiderstand zum Opfer, wurden nach und nach von der Erde eingefangen und gliederten sich schließlich dieser an.
Wichtig für unsere Betrachtung ist, daß Hörbiger den Mond von einem beträchtlich dicken Eispanzer bedeckt sieht.
Im vergangenen geologischen
Zeitalter, der Tertiärzeit, kreiste er noch als selbständiger
Planet, aber sein Vorgänger, der Tertiärmond - wie wir ihn
nennen wollen - stand damals als Trabant am irdischen Himmel.
Enger und enger zog dieser ebenfalls mit einem dicken Eispanzer
bedeckte Mond seine Bahnen, mehr und mehr beschleunigte er seinen Lauf,
und der Monat, der wie der heutige wohl auch einst 28 Tage zählte,
wurde immer kürzer. Er verminderte sich auf 15, 10, 5 und
bald auf 2 Tage. Als der Begleiter auf etwa 7 Erdradien (45 000
km) herangeschrumpft war, umlief er unseren Planeten in einem
einzigen Erdentage, er hatte die Erdrotation eingeholt, so daß
nun Erdentag und Monat gleich wurden. Dieser Zustand mag
Jahrtausende gedauert haben. Während dieser Zeit blieb er
immer über einem Meridian stehen, und zwar war er über Afrika
verankert. Seine Bewegung war eine tägliche Pendelung von
Norden nach Süden, etwa 4-5° nach jeder Richtung. Denn
wie die heutige Luna lief auch ihr Vorgänger nicht in der Ebene
der Erdbahn, sondern war gegen diese etwa 5° geneigt, worin die
Ursache der eben erwähnten täglichen Nordsüdpendelung zu
erblicken ist. Welche tiefgreifenden Veränderungen es bei
seinem Einfang auf Erden gab, werden wir später erfahren.
Aber auch die Erde bekam die Wirkung ihres näherkommenden Nachbarn jetzt eindringlich zu spüren. Schon unser heutiger Mond beeinflußt (obwohl noch um 60 Erdradien entfernt) doch bereits kräftig das Wasser unserer Ozeane (Ebbe und Flut). Um so stärker muß diese Wirkung werden, je mehr sich der Abstand eines Mondes verringert. Wie die Nachrechnungen ergaben, hatte der Tertiärmond in der Zeit des eintägigen Monats die Wassermassen unseres Planeten zu zwei ungeheuren Flutbergen zusammengezogen. Ein Schwerkrafts-(Zenit-)Flutberg lagerte über Afrika, das damals in seinen mittleren Teilen unter Wasser begraben lag, ein zweiter, der Fliehkrafts-(Nadir-)Flutberg wölbte sich über der Senke des Stillen Ozeans. Dadurch waren naturgemäß die mittleren, vor allem aber die höheren Breiten stark von Wasser entblößt. Der Mond hatte aber nicht nur das flüssige Element der Erde von Norden nach Süden äquatorwärts gezogen, sondern auch den Luftmantel. Die Atmosphäre sammelte sich ebenfalls in zwei großen Lufthügeln über den Flutbergen an. Die Pole waren der schützenden Hülle zum größten Teile entkleidet und die Erde dort dem Hereinfluten der Weltraumkälte fast schutzlos preisgegeben. Diese drang bis in die gemäßigten Breiten vor und begrub große Teile unseres Planeten unter gewaltigen Schnee- und Eisdecken. Eine Eiszeit war also gleichzeitig mit der Annäherung des Mondes hereingebrochen.
Von Norden und Süden wurden gegen den Gleicher gewaltige Gletscher vorgeschoben. Der Wohnraum auf Erden war klein geworden, alles Leben drängte sich in jenen äquatorialen Gegenden zusammen, die zwischen den beiden über Afrika und dem Pazifik verankerten Flutbergen lagen; im wesentlichen kamen also dafür die heutigen Sundainseln und das nördliche Südamerika in Frage. Eine Verbindung zwischen diesen Wohnstätten über die Ränder der Flutberge hinweg war unmöglich. Denn täglich pendelte der Mond einmal etwas nach Norden und etwas nach Süden, täglich setzte er die Flutberge auch nach diesen Richtungen in Bewegung und warf ungeheure Wellen, von deren Gewalt und Ausmaßen wir uns gar keine Vorstellung zu machen vermögen, sichelförmig auf Hunderte von Kilometern nach beiden Richtungen. Wo diese verebbten, herrschte Eiseskälte, so daß alles, was sie an Sinkstoffen mitschleppten und dort absetzten, bis zur nächsten Welle unfehlbar niederfror.
Aber auch die Erde bekam die Wirkung ihres näherkommenden Nachbarn jetzt eindringlich zu spüren. Schon unser heutiger Mond beeinflußt (obwohl noch um 60 Erdradien entfernt) doch bereits kräftig das Wasser unserer Ozeane (Ebbe und Flut). Um so stärker muß diese Wirkung werden, je mehr sich der Abstand eines Mondes verringert. Wie die Nachrechnungen ergaben, hatte der Tertiärmond in der Zeit des eintägigen Monats die Wassermassen unseres Planeten zu zwei ungeheuren Flutbergen zusammengezogen. Ein Schwerkrafts-(Zenit-)Flutberg lagerte über Afrika, das damals in seinen mittleren Teilen unter Wasser begraben lag, ein zweiter, der Fliehkrafts-(Nadir-)Flutberg wölbte sich über der Senke des Stillen Ozeans. Dadurch waren naturgemäß die mittleren, vor allem aber die höheren Breiten stark von Wasser entblößt. Der Mond hatte aber nicht nur das flüssige Element der Erde von Norden nach Süden äquatorwärts gezogen, sondern auch den Luftmantel. Die Atmosphäre sammelte sich ebenfalls in zwei großen Lufthügeln über den Flutbergen an. Die Pole waren der schützenden Hülle zum größten Teile entkleidet und die Erde dort dem Hereinfluten der Weltraumkälte fast schutzlos preisgegeben. Diese drang bis in die gemäßigten Breiten vor und begrub große Teile unseres Planeten unter gewaltigen Schnee- und Eisdecken. Eine Eiszeit war also gleichzeitig mit der Annäherung des Mondes hereingebrochen.
Von Norden und Süden wurden gegen den Gleicher gewaltige Gletscher vorgeschoben. Der Wohnraum auf Erden war klein geworden, alles Leben drängte sich in jenen äquatorialen Gegenden zusammen, die zwischen den beiden über Afrika und dem Pazifik verankerten Flutbergen lagen; im wesentlichen kamen also dafür die heutigen Sundainseln und das nördliche Südamerika in Frage. Eine Verbindung zwischen diesen Wohnstätten über die Ränder der Flutberge hinweg war unmöglich. Denn täglich pendelte der Mond einmal etwas nach Norden und etwas nach Süden, täglich setzte er die Flutberge auch nach diesen Richtungen in Bewegung und warf ungeheure Wellen, von deren Gewalt und Ausmaßen wir uns gar keine Vorstellung zu machen vermögen, sichelförmig auf Hunderte von Kilometern nach beiden Richtungen. Wo diese verebbten, herrschte Eiseskälte, so daß alles, was sie an Sinkstoffen mitschleppten und dort absetzten, bis zur nächsten Welle unfehlbar niederfror.
Wieder zeigte die Weltenuhr
eine neue Stunde an. Die Zeit des eintägigen Monats ging
vorüber, unmerklich begann der Begleiter von seinem Stand
fortzurücken, aber jetzt nicht mehr wie der heutige von Osten nach
Westen, sondern umgekehrt von Westen nach Osten; denn nun hatte er
nicht nur die Erdrotation eingeholt, sondern er begann sie zu
übertreffen, d. h. schneller als diese zu laufen. Ebenso
unmerklich wie der Mond setzten sich auch die Flutberge in
Bewegung. Der Nadirberg stieg aus der Wanne des Großen
Ozeans, wanderte über die Anden hinweg und bedeckte
Südamerika, der Zenitberg zog nach der Sundawelt ab. Das
Leben zwischen den beiden Flutbergen ward ebenso langsam vor ihnen
hergeschoben. Der damalige Mensch wird es kaum als Wanderung
empfunden haben, wenn er den fischreichen Lagunen folgte, die
allmählich flacher wurden und nach Osten zurückgingen, oder
auf der anderen Seite vor dem ansteigendem Meere auswich. So
mögen Fauna und Flora wohl mehrmals um den Erdball herumgezogen
sein, ohne daß etwa Beunruhigendes darin lag; denn der Mensch
hatte Zeit genug; sich an neue Verhältnisse zu gewöhnen.
Aber andere Gewalten setzten
nun um so stärker ein.
Während des eintägigen Monats war durch den Begleiter die Erde in ihrer Gestalt verändert worden. Nicht nur das Wasser wölbte sich über Afrika dem Monde entgegen, auch der Erdkörper selbst folgte, wenn auch in geringerem Maße, diesem Zuge, so daß die Erde nach der Luna zu etwas zugespitzt erschien. Demgegenüber lag das stumpfe Ende unter dem Nadirberg im Stillen Ozean. Etwa übertrieben gesagt, hatte unser Planet grundsätzlich eine Eiform angenommen. Als nun der Mond zu wandern begann, versuchten Eispitz und Eistumpf zu folgen. Das war in diesem Falle natürlich viel schwerer als für die leicht beweglichen Flutberge. Man kann sich kaum vorstellen, welche Kräfte am Erdkörper zerrten, welche Katastrophen einsetzten, als er dem nun wieder langsam wandernden Begleiter sich anzugleichen versuchte.
Der Mond war nun schon am Himmel zu recht bedenklicher Größe herangewachsen, an Durchmesser mehr als zehnmal, an Oberfläche aber weit mehr als hundertmal so groß wie der heutige. Auch das Leben zwischen den Flutbergen begann jetzt ungemütlich zu werden; denn diese folgten im nächsten Zeitabschnitt rascher ihrem Zwingherrn und trieben Menschen und Tiere in immer beschleunigterem Maße vor sich her.
Doch dieser Zustand dauerte nicht lange. Infolge seiner Trägheit konnte das Wasser nicht mehr so schnell nachströmen. Die Flutberge blieben immer mehr zurück, stauten sich an der Vorderseite zu gewaltigen Ausmaßen, während auf der Rückseite die letzten Teile langhingezogen hinterher schleppten. Schließlich kam es so weit, daß der vorwärts drängende Wasserhügel schon die nachhinkenden Teile des vorausgehenden erreichte und endlich mit diesem zusammenfloß. Damit war das Flutbergzeitalter überwunden und die Flutberge zu einer einzigen, gewaltigen Gürtelhochflut um den Gleicher vereinigt.
Alles Leben in der heißen Zone war bis auf ganz wenige Punkte dem Untergang geweiht. Nur die Anden, das Hochland von Abessinien und die höchsten Teile der malaiischen Inselwelt traten als einsame, verlorene Posten aus der umbrandenden, rastlos nach Osten fließenden Wasserwüste hervor und trugen in diesen Breiten die kärglichen Reste des Lebens. Aber es waren nicht die einzigen Asyle der Menschenwelt. Bei der immer ruheloser werdenden Wanderung um den Erdball wurden einzelne Stämme auch nach den Seiten abgedrängt und führten nun zwischen der Gürtelhochflut und den weit nach Süden und Norden reichenden Gletscherrändern ein zwar ziemlich rauhes, aber durchaus nicht immer entbehrungsreiches Dasein.
Während des eintägigen Monats war durch den Begleiter die Erde in ihrer Gestalt verändert worden. Nicht nur das Wasser wölbte sich über Afrika dem Monde entgegen, auch der Erdkörper selbst folgte, wenn auch in geringerem Maße, diesem Zuge, so daß die Erde nach der Luna zu etwas zugespitzt erschien. Demgegenüber lag das stumpfe Ende unter dem Nadirberg im Stillen Ozean. Etwa übertrieben gesagt, hatte unser Planet grundsätzlich eine Eiform angenommen. Als nun der Mond zu wandern begann, versuchten Eispitz und Eistumpf zu folgen. Das war in diesem Falle natürlich viel schwerer als für die leicht beweglichen Flutberge. Man kann sich kaum vorstellen, welche Kräfte am Erdkörper zerrten, welche Katastrophen einsetzten, als er dem nun wieder langsam wandernden Begleiter sich anzugleichen versuchte.
Der Mond war nun schon am Himmel zu recht bedenklicher Größe herangewachsen, an Durchmesser mehr als zehnmal, an Oberfläche aber weit mehr als hundertmal so groß wie der heutige. Auch das Leben zwischen den Flutbergen begann jetzt ungemütlich zu werden; denn diese folgten im nächsten Zeitabschnitt rascher ihrem Zwingherrn und trieben Menschen und Tiere in immer beschleunigterem Maße vor sich her.
Doch dieser Zustand dauerte nicht lange. Infolge seiner Trägheit konnte das Wasser nicht mehr so schnell nachströmen. Die Flutberge blieben immer mehr zurück, stauten sich an der Vorderseite zu gewaltigen Ausmaßen, während auf der Rückseite die letzten Teile langhingezogen hinterher schleppten. Schließlich kam es so weit, daß der vorwärts drängende Wasserhügel schon die nachhinkenden Teile des vorausgehenden erreichte und endlich mit diesem zusammenfloß. Damit war das Flutbergzeitalter überwunden und die Flutberge zu einer einzigen, gewaltigen Gürtelhochflut um den Gleicher vereinigt.
Alles Leben in der heißen Zone war bis auf ganz wenige Punkte dem Untergang geweiht. Nur die Anden, das Hochland von Abessinien und die höchsten Teile der malaiischen Inselwelt traten als einsame, verlorene Posten aus der umbrandenden, rastlos nach Osten fließenden Wasserwüste hervor und trugen in diesen Breiten die kärglichen Reste des Lebens. Aber es waren nicht die einzigen Asyle der Menschenwelt. Bei der immer ruheloser werdenden Wanderung um den Erdball wurden einzelne Stämme auch nach den Seiten abgedrängt und führten nun zwischen der Gürtelhochflut und den weit nach Süden und Norden reichenden Gletscherrändern ein zwar ziemlich rauhes, aber durchaus nicht immer entbehrungsreiches Dasein.
Unter diesen Wohnstätten
interessiert uns am meisten die Gegend des südlichen Frankreich
und Spanien. Hier haben die Eiszeitmenschen reiche Spuren
hinterlassen. Ihre Höhlenmalereien, ihre prachtvollen
Schnitzereien, ihre Waffen und Altäre und noch viel anderes geben
ein Bild von der verhältnismäßig hohen Kultur, der
Technik und dem Schönheitssinn der damaligen Bewohner. Wir
verdanken es nicht zum wenigsten der unermüdlichen Ausdauer
Hausers, diese alten Zeugen menschlichen Fleißes und menschlichen
Könnens aus der letzten Eiszeit ans Tageslicht gezogen zu
haben. Bei seinen Grabungen legte er auch ganze Skelette
bloß, z. T. regelrecht beigesetzt und mit Totengaben
versehen. Das läßt auf einen Kult schließen, der
weit über die Anfänge des Primitiven hinausreicht. Die
Skelette zeigen in der Mehrzahl hohen Wuchs, die Schädel, Formen
und einen Inhalt, der dem heutigen Nordmenschen
gleichkommt. Der Vergleich mit diesem weist mit hoher
Wahrscheinlichkeit darauf hin, daß wir in den eiszeitlichen
Renntierjägern, besonders dem Aurignac- und Cro-Magnon-Menschen
die Stammväter des Nordmenschen, somit also unsere eigenen
Ahnen zu erblicken haben. Jede gute Kulturgeschichte hat deshalb
dieser versunkenen Welt ihre Spalten geöffnet und ihre Bedeutung
gewürdigt.
Wieder schwanden
Jahrtausende. Der Mond war auf zwei Erdradien (12 000 km)
herangeschrumpft. Die Gürtelhochflut stieg weiter. Der
Erdtrabant war scheinbar zu ungeheuren Ausmaßen herangewachsen
und bedeckte einen großen Teil des Horizonts. Wie ein
dräuender Riese brauste er jetzt über den Himmel dahin,
Unruhe und Unsicherheit in die Atmosphäre tragend.
Stürme begannen die Tropen zu umrasen; denn in der Entfernung von
zwei Erdradien, d. h. als der Mond von der Erdoberfläche nur noch
einen Erdradius abstand, umlief er diese vier- bis fünfmal
täglich. Auch auf den Erdkörper wirkte sich diese
Annäherung immer fühlbarer aus. Hatte er in dem
Zeitalter der Flutberge im Prinzip Eiform angenommen, so wölbte
sich jetzt die äquatoriale Zone dem nahen Begleiter entgegen und
plattete sich an den Polen viel, viel stärker als heute ab.
Die Erdform näherte sich also der Gestalt einer Linse.
Dementsprechend wirkte von den Polen gegen die mittleren Breiten ein
gewaltiger Druck, vom Äquator her aber ein mächtiger Zug, die
Ursache von Faltungen, Zerreißungen, Brüchen u. dgl.
War auch die Wirkung der Luna
auf unseren Planeten nachhaltig, z. T. sogar katastrophal, unendlich
viel schwerwiegender war der Einfluß der Erde auf den rasend
schnell näherkommenden Mond. Es mögen noch ein paar
Jahre, vielleicht nur Monate unserer heutigen Zeitrechnung verflossen
sein, und der Tertiärmond umschwang unsern Mutterstern in nur noch
1.8 Erdradien Abstand. In dieser Zeit wirkte die irdische
Anziehungskraft so stark, daß sie an den Flanken den inneren
Zusammenhang des Mondes zu zerreißen begann. Dieser fing
an, über den Tropen zu zerfallen. Zuerst löste sich der
Eispanzer auf und schoß spiralig in die Erdatmosphäre
ein. Sobald die gewaltigen Eisblöcke die Lufthülle
durchsausten, zerplatzten sie unter der Reibungswärme und kamen z.
T. als Regen, z. T. als verheerendes Hagelunwetter herunter. Nun
folgte die erdige Zone, die sich noch mit dem Eis bzw. Wasser
vermischte und als mächtiger Schlammregen herniederging.
Zuletzt zerriß auch der feste, aus Erzen bestehende Kern.
Selbst bergegroße Trümmer stürzten herab. Die
Elemente waren in ununterbrochenem Aufruhr. Tagelang dauerte es,
ehe der Steinhagel nachließ, die dichte Finsternis verschwand und
es wieder Licht wurde. Die Erde hatte sich die gesamte Mondmasse
einverleibt.
Mit dem Zerfall des
Erdbegleiters war auch der Faktor hinweggefallen, der die mächtige
Gürtelhochflut am Äquator zusammengehalten hatte. Als
er niedergebrochen war, liefen infolge des Beharrungsgesetzes wohl die
Wassermassen noch kurze Zeit in der gewohnten Bahn weiter, begannen
erst langsam, dann immer schneller und schneller über ihre Ufer zu
treten und als ungeheurer Wasserschwall in ihre alten Betten nach
Norden und Süden abzuströmen. Unaufhörlich stieg
das Wasser in den mittleren und höheren Breiten, bedeckte die
Berge und ließ nur die höchsten Erhebungen frei. An
den Polen schlugen die vom Äquator kommenden Fluten zu einer
ungeheuren Brandungswelle zusammen, liefen zurück, schwappten in
den Tropen wieder empor, wanderten nochmals nach Norden und Süden
und verebbten allmählich. Langsam trat das Land wieder aus
der Wasserwüste heraus, bereit abermals Leben zu tragen.
Eine neue Zeit war heraufgezogen.
Dies in großen Zügen
die Ereignisse und Erscheinungen des letzten Tertiärmondzeitalters
mit abschließendem Kataklysmus (Großkatastrophe).
Versuchen wir, nun im Licht dieser kosmostechnischen Erkenntnisse dem
Urwissen und den Urberichten der Menschheit gerecht zu werden. .........